WGF Ostersonntag 24 Forst/Abersfeld
Ansprache WGF Ostersonntag 24 Forst/Abersfeld
Welchen Schrecken hat wohl Maria von Magdala am Ostermorgen empfunden, als sie zum Grab Jesu geeilt war und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Sie konnte das Ganze nicht fassen - sie lief zu Petrus und Johannes und berichtete, dass der Leichnam Jesu nicht mehr dort war. Die beiden Apostel gingen zum Grab und fanden nur noch die Leinentücher - jedoch glaubte nur Johannes an die Auferstehung seines Meisters - während die anderen Jünger das noch nicht verstanden. Soweit verständlich - oder doch nicht?
Denn auch wir, liebe Schwestern und Brüder, tun uns mit der Auferstehung schwer - zumal uns ja auch die Erscheinungen Jesu fehlen. Der zweite Teil des heutigen Evangeliums bietet da jedoch eine ganz anders geartete Erzählung. Maria von Magdala ist da die Hauptperson, die Jesus mit einem Gärtner verwechselt, ihn jedoch an der Art seiner Anrede „Maria“ erkennt und daraufhin mit dem liebevollen Wort „Rabbuni“ - sprich: „Meister“ antwortet. Die Beziehung zwischen Maria und Jesus war offensichtlich von einer besonderen Weise geprägt - und so wurde sie zur Erstverkünderin der Auferstehung - zur Apostolin der Apostel.
Ohne die vielen Zeugen der Erscheinungen Jesu, von denen die Erste Lesung aus der Apostelgeschichte spricht, wäre diese Lehre wohl nicht im ganzen Römischen Reich verbreitet worden - auch wenn dazu noch die Geistsendung und die Verkündigung des Paulus hinzukommen mussten. Petrus jedenfalls trat als unerschrockener Zeuge auf, der auf die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu hinweist und den Bezug zum Ersten Testament herstellt, wenn er sagt: „Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt.“
Schließlich die Zweite Lesung aus dem ersten Korintherbrief - hier wird Jesus mit dem Paschalamm gleichgesetzt und darauf verwiesen, dass der ungesäuerte Teig, der zum jüdischen Paschafest gehört, im österlichen Ritus für das neue Leben in „Aufrichtigkeit und Wahrheit“ steht. Der Glaube an das österliche Leben führt zu einer neuen Lebenswirklichkeit, die bereits damals wie auch heute sichtbar und greifbar wird.
Trotzdem - liebe Schwestern und Brüder - bleibt immer noch bei vielen Menschen die Skepsis, ob nicht mit dem Tod Jesu am Kreuz alles aus und vorbei gewesen sei. Für mich sprechen hier vor allem die Auswirkungen des Osterglaubens über zweitausend Jahre Kirchengeschichte hinweg von dessen Wahrheit, auch wenn es immer um eine Glaubensfrage geht. Angefangen von den ersten Zeugen bis in unser Jahrhundert wurde dieser Glaube weitergetragen - und eint auch die vielen christlichen Konfessionen und Kirchen. Denn ohne diese Überzeugung wäre der ganze christliche Glaube wertlos - wie es der Apostel Paulus oft bemerkt hat.
Liebe österliche Gemeinde,
nach so vielen ernsten Gedanken muss noch eine Anekdote folgen, die das befreiende Osterlachen begründet: Ein Dekan erklärt seinen Pfarrern, dass ihre Predigten auch mit der entsprechenden Mimik versehen sein müssten - wenn also vom Himmel die Rede ist, müsste ihr Gesicht also vor Freude strahlen. Ein Pfarrer fragt, wie das dann wäre, wenn von der Hölle die Rede ist. Darauf der Dekan: Da reicht dein gewöhnlicher Gesichtsausdruck völlig aus…
Diakon Dr. Michael Wahler
Osternachtsliturgie 24 Hausen
Ansprache Osternachtsliturgie 24 Hausen
Wie heißt es so schön im Psalm 118, liebe Schwestern und Brüder? „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden.“ Was soll das heißen? In der Sprache der Baubranche war zunächst ein wenig einladender Stein - vielleicht sehr kantig oder mit Rissen versehen und deshalb kaum geeignet, als Stütze im Mauerwerk zu dienen -, der deshalb von den Bauleuten weggeworfen wurde und später zu Kies werden sollte - doch plötzlich wird dieser Stein zum Fundament, zum Eckstein, der Stabilität verheißt, auf den man bauen kann. Wie ist das geschehen? Hat man ursprünglich die Qualität verkannt - oder kam diese erst später in den Blick? Wie sich doch manchmal die Ausrichtung ändert, ja sich sogar um 180° dreht!
Ist es nicht so auch in unserem Leben, liebe österliche Gemeinde? Manches Unscheinbare wird plötzlich wertvoll - mancher Abfall wird zum Wertstoff - manches Vergangene wird sehr aktuell. Altes, längst Verdrängtes, steht im strahlenden Licht. Das kann ein modisches Accessoire sein - Stichwort: Vintage -, das kann eine musikalische Wiederentdeckung sein - unter dem Aspekt: Retro -, das kann auch eine totgeglaubte Beziehung sein - mit dem Vermerk: Revival.
Trotzdem bleibt die Frage: hat das auch etwas mit Ostern zu tun?
Ja - und zwar recht deutlich! Schien doch am Karfreitag mit dem Tod Jesu am Kreuz alles zu Ende - der Meister zu Tode gequält - die Jünger in alle Winde zerstreut - der Hohe Rat auf dem Siegerpodest - also alles verloren und vorbei. Nichts mehr von „Messias“ und dem bereits angebrochenen Reich Gottes! Nur noch Tristesse, Dunkel und Verzweiflung!
Doch dann der Paukenschlag! Das Grab ist leer - der himmlische Vater hat den göttlichen Sohn auferweckt und erhöht - ein Glaube, der zuerst von Maria von Magdala und dann dem Lieblingsjünger Johannes geteilt wird - während die Apostel noch lange zweifelnd und ungläubig sind. Und es bedarf zahlreicher Erscheinungen des Auferstandenen, um seine Anhänger zu überzeugen. Aber spätestens mit der Geistsendung ereignete sich ein Aufbruch, der die junge Kirche begründet und wachsen lässt. Jesus, der in einer neuen Wirklichkeit lebt, hat den Tod überwunden - aus dem verworfenen Stein ist der Eckstein seiner Kirche geworden.
Wenn wir das nachher symbolhaft ausdrücken, liebe Schwestern und Brüder, indem wir aus den Steinen um das Kreuz herum Blumen sprießen lassen, dann kann uns bewusst werden, was Ostern bedeutet: aus dem Totgesagten erwächst neues Leben - aus Klageliedern wird Osterjubel - aus dem Herz aus Stein wird ein Herz aus Fleisch!
Christus ist zum Eckstein unseres Lebens geworden!
Welche Konsequenzen ziehen wir aber daraus? Da gibt es viele Möglichkeiten - ich möchte nur eine nennen, die mir sehr einfach -manchmal aber auch schwierig - erscheint: Freude auszustrahlen -Optimismus zu verbreiten - und ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Versuchen wir es einmal in und nach diesem Gottesdienst!
Liebe österliche Gemeinde,
bei einem Pfarrertreffen erklärt der Dekan, dass bei der Predigt auch die Mimik des Gesichts eine Rolle spielen würde. Wenn die Mitbrüder vom Himmel erzählen, müssten sie ein strahlendes Lächeln aufsetzen. Ein Pfarrer fragt: „Und wenn ich von der Hölle spreche?“ Darauf der Dekan: „Da können Sie den Gesichtsausdruck behalten, den Sie gerade jetzt haben…“
Diakon Dr. Michael Wahler
Karfreitag 24 Mainberg/Hausen
Ansprache Karfreitag 24 Mainberg/Hausen
„Viel‘ Steine gab’s und wenig Brot“ - so charakterisiert ein bekanntes Sprichwort die Struktur der Landwirtschaft in der Schweinfurter Rhön - also auch in Mainberg und Hausen. Im Gegensatz zur Flur um Gochsheim und Sennfeld - oder gar im Ochsenfurter Gau - war man bei uns „steinreich“ - sprich: reich an felsigem Untergrund und lockerem Gestein, aber arm an ertragreicher Krume, um diesen alten Ausdruck auch wieder einmal zu gebrauchen. Also insgesamt eine wenig hoffnungsvolle Aussicht als Nachwuchsbauer - und dazu noch die fränkische Realteilung!
Ein Blick auf die Landwirtschaft - heute am Karfreitag - früher gerne auch genutzt zu besonders intensiver Tätigkeit, um die lutherischen Mitbürger zu ärgern? Mir geht es nicht um Subventionen oder die Besteuerung des Agrardiesels, liebe Schwestern und Brüder - ich will mit dieser Beschreibung das Thema dieser Karwoche, nämlich dem Symbol des Steines, uns etwas näher bringen - und dazu eignen sich Bilder aus dem Lebensumfeld des Bauern sicher ganz gut. Also zurück zu den Steinen!
Wenn wir die Schrifttexte des Karfreitags betrachten, so liegen auf dem Gottesknecht beim Propheten Jesaja ganze Felsbrocken - und das gilt für Jesus im Hebräerbrief und der Passionsgeschichte nach Johannes genauso. Diese Lasten sind erdrückend - im wahrsten Sinn des Wortes! Allein schon die schiere Masse und das Gewicht solcher Steine zermalmen jeden Menschen - und das ist nicht nur körperlich zu verstehen. Auch Geist und Seele können mit solchen Steinen belastet sein - und ich glaube, davon kann jeder von uns sein eigenes Lied singen. Aber es lohnt sich, darüber etwas näher nachzudenken!
Welche Ereignisse können für unser Inneres, liebe Schwestern und Brüder, also quasi zu Steinen geworden sein? Das fängt mit Enttäuschungen aller Art an - ob in Beziehungen, in der Schule, am Arbeitsplatz, unter Freunden oder in sonstígen sozialen Bezügen - das setzt sich fort mit Anfeindungen und Verleumdungen - wobei auch hier die schon benannten Felder erneut auftauchen, vielleicht noch verstärkt durch öffentliche Formen und die Wirkungen der „unsozialen Medien“ - und das kann in Gerichtsprozessen und körperlichen Angriffen enden. Dazu kommen dann noch Verlusterfahrungen, Trauer und Vereinsamung - wen wundert es da, dass unser Herz „versteinert“ - und zu keiner menschlichen Regung mehr fähig ist!
Gerade die Passionsgeschichten erzählen hier über Jesus etwas ganz anderes - auch wenn eine solche Versteinerung völlig verständlich gewesen wäre, verzeiht er doch seinen Anklägern und kümmert sich darum, dass seine Mutter weiterhin versorgt ist. Sein Herz bleibt trotz aller Schmerzen und allem Leid offen für die Menschen - und darin können wir auch den Grund für seinen Tod am Kreuz erkennen - die Erfüllung des göttlichen Auftrags, alle Menschen von ihrer Sünde und Schuld zu erlösen.
In diesem Sinne, liebe Schwestern und Brüder, können wir nachher bei der Kreuzverehrung symbolisch unsere Steine unter das Kreuz legen, so dass uns „ein Stein vom Herzen fällt“, wie es ein weiteres Sprichwort sagt. Und es bestätigt sich erneut der Ruf aus der Liturgie des Karfreitags:
„Im Kreuz ist Heil - im Kreuz ist Leben - im Kreuz ist Hoffnung!“
Amen.
Diakon Dr. Michael Wahler
Palmsonntag 24 Hausen
Ansprache Liturgie Palmsonntag 24 Hausen
Was fällt Ihnen zum Thema „Stein“ sofort ein, liebe Schwestern und Brüder? Vermutlich einige Sprichwörter manche meist negative Eigenschaften bei Menschen vielleicht auch die Bedeutung des Steines als Fundament und Garant für Stabilität. Denken wir nur an den Mann, der sein Haus nicht auf Sand, sondern auf Fels gebaut hat oder an Simon, der den Namen „Petrus = Fels“ von Jesus selbst erhalten hat. Es gibt also auch positive Eigenschaften des Steines – die wenig Schmeichelhaften sind aber wohl in der Überzahl.
Warum habe ich also diesen kalten Gegenstand zum Symbol für die Karwoche und Ostern in diesem Jahr gewählt? Diese Frage habe ich schon in der Einführung gestellt und damit begründet, dass Gott bei uns Menschen das „Herz aus Stein“ durch ein „Herz aus Fleisch“ ersetzen will, d.h. uns aus Versteinerung und Härte zu neuem Leben in Gemeinschaft führen will. Und die Motivation für eine solche Deutung ergibt sich aus den aktuellen Ereignissen in unserem kleinen und großen Umfeld, das ich etwas näher beleuchten will.
Das beginnt damit, dass nur noch das selbstoptimierte Individuum maßgeblich erscheint voller Arroganz und Geltungsbedürftigkeit wobei allein schon der Gedanke an Hilfsbedürftigkeit verachtet wird. Das setzt sich fort in mangelnder Solidarität innerhalb ganz verschiedener Formen der Gemeinschaft selbst in Beziehungen und ganz besonders im Arbeitsleben. Und das pervertiert dann in autokratischen Systemen mit Unterdrückung und Repression, die dann oft zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit unvorstellbaren Härten führen. Insgesamt scheint unsere Welt immer mehr zuversteinern!
Was hat das aber mit den heutigen Schrifttexten zu tun, werden Sie möglicherweise fragen, liebe Schwestern und Brüder? Sowohl der Prophet Jesaja wie auch Jesus selbst haben unter solchen Härten gelitten wobei doch Gott selbst Liebe und Barmherzigkeit propagiert und auch anwendet. Die Frohe Botschaft ist ganz davon geprägt, dass die Nächstenliebe das entscheidende Kriterium für die Nachfolge Jesu ist und diese ihn dazu bewogen hat, sein Leben am Kreuz für die Erlösung aller Menschen hinzugeben. Das ist das genaue Gegenteil zu einem verhärteten Glauben, zu einem starren Rechtssystem, zu Machtausübung und Besitzgier, wie wir es leider in der langen Kirchengeschichte erfahren haben und auch heute noch erfahren. Da werden doch kleine Lockerungen durch Papst Franziskus gleich mit Häresievorwürfen konterkariert!
Noch eine Anmerkung, warum ich das weiße Skapulier mit dem Hinweis auf Liborius Wagner trage denn genau heute vor 50 Jahren wurde dieser Märtyrerpriester in Rom seliggesprochen. Er war auch ein Zeuge für den Glauben natürlich in einem ganz anderen Umfeld als zur Zeit Jesu. Trotzdem: seine unbeirrbare Treue kann auch uns noch ein Vorbild sein in einer Zeit, wo diese Tugend kaum mehr gefragt ist.
Liebe Schwestern und Brüder,
schauen wir also in dieser Woche gerade auf unsere eigenen Verhärtungen und bringen wir diese besonders am Karfreitag vor Gott denn dann wird uns an Ostern bestimmt „ein Stein vom Herzen fallen“. Und das Motiv von „Kreuz und Taube“ auf meiner roten Dalmatik versinnbildet auch den Wandel, der durch Erlösung, Auferstehung und Geistsendung erfolgen kann und wird denn der Herr kann selbst aus Steinen Brot schaffen.
Amen
Diakon Dr. Michael Wahler
Büttenpredigt 24
Büttenpredigt 2024
1.Liebe Schwestern, liebe Brüder,
ist heut‘ nötig Büttenpredigt?
Ampel wird ja ständig müder -
ob sich’s dieses Jahr erledigt?
Fragt sich Söder - und wohl auch Merz -
doch es bleibt da die K-Frage -
dabei es klingt wie schlechter Scherz -
so verworren ist die Lage!
2. Wenn Evangelien wir betracht’n -
geht’s um kranker Menschen Heilung -
sehr viele sie zu Jesus bracht’n -
er gab ihnen Mut und Peilung -
ob Aussatz, Fieber, sonst Gebrech’n -
selbst von Dämonen er befreit -
wir heute von Psychosen sprech’n -
da ging der Menschensohn sehr weit!
3. Gebete braucht wirklich die Welt -
denn es werden stets mehr Kriege -
in Russland leider Putin bellt -
Ukraine fehlen Siege -
jetzt neu gemeiner Überfall
der Hamas auf Zivilisten -
den antiseminitisch‘ Drall
bei uns muss man noch ausmisten!
4. Klimakrise trifft uns alle -
Hitze - Trockenheit - Starkregen -
muss man fliegen kurz nach „Malle“?
Heimaturlaub bringt auch Segen!
Für Klimakleber leicht Rezept -
lasst sie doch frieren eine Nacht -
so mit eig’nen Waffen neppt -
doch nehmt euch vor Traktor’n in Acht!
5. Manch‘ Gebete braucht’s auch heute -
Bundeskanzler noch nie hatte
so wenig Rückhalt - die Leute
legen an sehr niedrig‘ Latte -
doch stets der Scholzomat nur drischt
dürres Stroh - dabei sich versteht
ls hochintelligent - erwischt
bei Warburg-Bank? Ob er dann geht?
6. Nicht besser Ampel mir erscheint -
sich gegenseitig keifen gern -
bei Schuldenbremse nicht geeint -
sie leben auf ‚nem and’ren Stern!
Heizungsgesetz handwerklich schlecht -
und ständig reformiert wird’s dann -
da gibt’s Kritik - völlig zu Recht -
wer sich davor noch retten kann?
7. Nun - eine Etage tiefer -
in Bayern war die Landtagswahl -
der Aiwanger - wonach rief er?
Demokratie - Markus wurde fahl!
Solcher Unsinn brachte Stimmen
für Freie Wähler - man glaubt’s kaum -
denn er müsst‘ Lautstärke dimmen -
trägt doch aus Jugend braunen Saum!
8. Die AfD kann das besser -
ist jetzt stärkste Opposition -
und verkündet immer kesser -
dass sie gewinnt an Kondition -
wie wohl geh’n aus Wahl‘n im Osten?
da zeigt sich plötzlich Bürger’s Mut -
er demonstriert geg‘n Vollpfosten -
für unser Land - und das ist gut!
9.Ganz anders läuft’s bei uns vor Ort -
denn Schonungen wird bald zur Stadt -
es fehlt an nichts - hört auf mein Wort -
wenn Rossmann kommt - da Dorf aufwart‘
mit Einrichtungen aller Art -
Grundschule öffnet dieses Jahr -
Realschulplän‘ noch etwas zart -
du musst nur noch nach „Schöni“ fahr‘!
10. Die Blaskapellen leben auf -
was auch für meist‘ Vereine gilt -
Strukturbeihilfen zeigen Lauf
der Dorfentwicklung - Bürger schilt -
zwar hohe Steuern auf den Grund -
und die Gebühr’n für den Friedhof -
bei Fremden bleibt offen der Mund -
Schonunger Bürger sind nicht doof!
11. In der katholisch‘ Kirch‘ geht’s rund -
Papst setzt US-Bischof glatt ab -
der Häresie-Vorwurf tat kund -
die Kurie hält ihn oft auf Trab -
von Glaubenspräfekt neuer Ton -
Segnungsbegriff wird neu gefasst -
Reaktionen weltweit schon
ernüchternd - ob’s zum Süden passt?
12. Zu Ende Synodaler Weg -
gar nicht beliebt im Vatikan -
doch ich mich weiter nicht aufreg‘ -
Reform man nicht aufhalten kann.
Katholik‘ntag in Erfurt’s Dom -
wird wohl kleiner auch ausfallen -
im Heil’gen Jahr geht es nach Rom -
Würzburg’s Pilger dorthin wallen.
13. Gemeinschaft steht im Vordergrund
in unser’m Pastoralen Raum -
und ich mach‘ es recht deutlich kund:
Liborius Wagner kennt man kaum -
Seligsprechung - schon lange her -
es geschah vor fünfzig Jahren -
jetzt wird gefeiert wirklich sehr -
hoffentlich seh’n Pilgerscharen!
14. Mein eig’nes Jubiläumsjahr
ist ja beendet - war recht schön -
nun bin ich siebzig - das ist klar -
Fanfaren müssen nicht ertön‘!
Ich konnt‘ dabei nicht einladen
die ganz Gemeinde - bräucht‘ sonst Zelt -
g‘scholten ward - nach Strich und Faden -
vom Faschingstrio - wie’s gefällt!
15. Ein kurzer Blick auf dieses Jahr
sei mir jetzt nun auch noch erlaubt -
mit Kilian’s Haupt nach Irland fahr‘ -
zuvor der Bischof es abstaubt -
und viele Reisen plant der Frank -
jetzt bald nach Wien - in weite Welt -
ihr seid gesund - sagt: Gott sei Dank!
Und wartet, bis der Wecker schellt!
16. Zu Ende ist nun das Gedicht -
ich wünsche weiter Fröhlichkeit -
ich habe meine eig’ne Sicht
auf diese Welt - doch seid bereit -
zu helf‘n Freunden - und auch Nachbarn -
so wird erfüllt Jesu Auftrag -
wenn wir nachher nach Hause fahr’n -
will ich nicht hören eine Klag‘! - Helau!
Diakon Dr. Michael Wahler






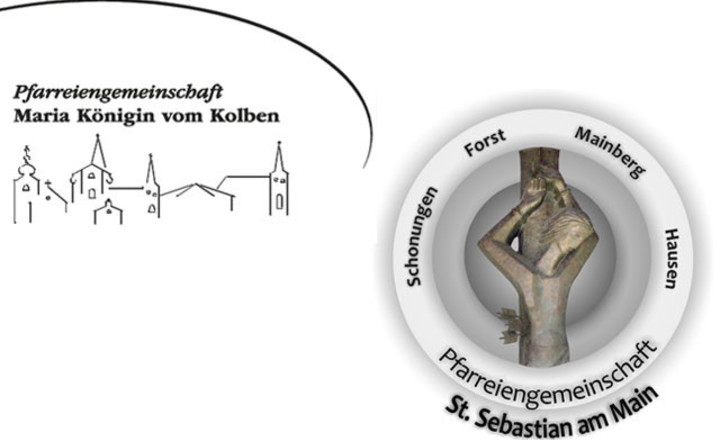
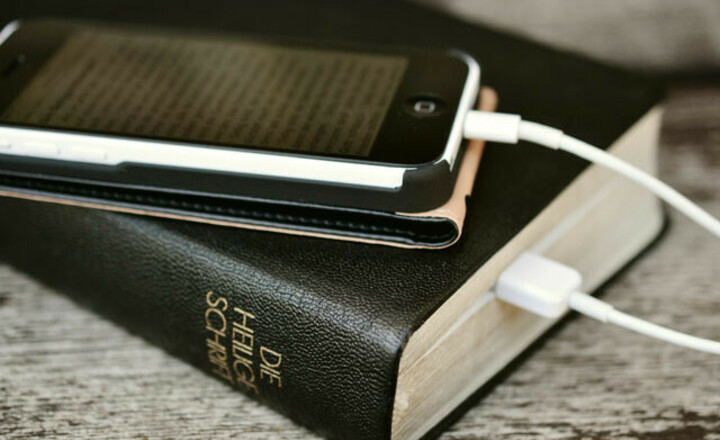



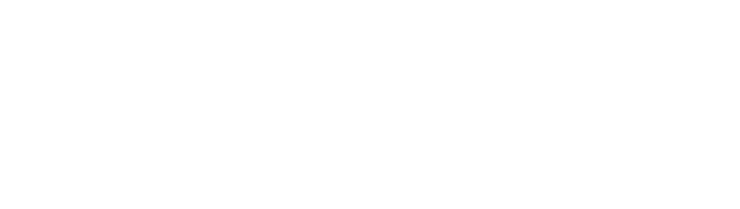
 Katholische Kirche
Katholische Kirche